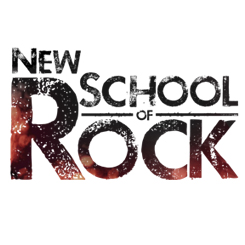ACRASSICAUDA „Gilgamesh“
- Details
- Category: Reviews
- Published on Sunday, 12 July 2015 14:31
- Written by Tobias Natter
Die außergewöhnliche (Enstehungs-)Geschichte einer außergewöhnlichen Band und ihres Debut-Albums.
Acrassicauda sind irakische Kriegsflüchtlinge, eine Band im Spannungsfeld ideologischer Konflikte. Ihre Musik erzählt davon. Genre: Thrash Metal.
Jede Band ist mehr als „nur“ ihre Musik, sie ist, wie man so schön sagt, die Summe ihrer einzelnen Teile. Ein ganz großer Teil dieser Summe ist dabei immer auch die Historie einer Band bzw. ihrer Protagonisten. Sie, die Geschichte, die Chronologie, definiert das Schaffen eines jeden Musikers. Sie skizziert warum wer weshalb wie Musik macht. Selbst Habitus und Attitüde erklärt sie zumindest zum Teil. Und von denen gibt es gerade im weiten Feld der Rockmusik genügend. Wäre Liam Gallaghers Benehmen auf- und abseits der Bühne dasselbe exaltierte ohne seine schwierige Adoleszenz? Hätte Mister James Hetfield "The God that Failed" geschrieben, ohne die biografischen Erlebnisse, die ihn prägten; wären seine Riffs ähnlich zornig ausgefallen? Wohl kaum. Die musikalische Substanz einer Band ist quasi die Projektion ihrer Geschichte und ihre Geschichte das Substrat ihrer musikalischen Substanz. Jeder geht mit seiner (schmerzvollen) Geschichte (anders) um, auch im musikalischen Sinne. Der eine leise, der andre laut. In der Rockmusik - und hier besonders im Heavy Metal -, passiert das bekanntlich meist laut und zornig. Nichts ist befreiender als all den Zorn, die Wut, Verzweiflung und Angst hinaus zu brüllen. Das gilt für den Vortragenden genauso wie für den Rezipienten. Letzterer braucht nur im trauten Heim die Anlage aufzudrehen, schon kann er im Chor seiner Heroen miteinstimmen. Man hat vielleicht ähnliches durchgemacht, fühlt sich verstanden, teilt den Weltschmerz. Das eint: Katharsis mit ordentlich Dezibel. Nur was, wenn all der Weltschmerz seinen Ausdruck statt in pathetischen Lyrics, die von Krieg, Blut und Heldentaten erzählen, bittere Realität ist? Was, wenn für einmal nicht skandinavische Kriegsmythen besungen werden müssen, um von Tragik, Tod und Teufel zu berichten? Was, wenn Musik und Text nun erlebte Versionen all dessen sind: Krieg und Verzweiflung am eigenen Leibe selbst erlebt und keine weltfremden „Fire and Blood-Gschichten“ von MANOWAR (bei allem gebührenden Respekt)? Dann eben wird aus „Gschichten“ eine (Band)Geschichte der etwas anderen, brutaleren Art. Dann ist Musik, dann ist Heavy Metal die Manifestation einer Bandbiografie, die es wahrlich wert ist, erzählt zu werden. Denn die Geschichte dieser Band ist außergewöhnlicher, als die der meisten; und miteinstimmen im Chor der Helden kann man beim Hören ihres Debutalbums trotzdem oder gerade deswegen.
Bagdad, Irak, 2003. Es herrscht Krieg. Die US-amerikanische Armee will den irakischen Diktator Saddam Hussein beseitigen. Was dies für die Bewohner Bagdads bedeutet, ist klar. Der Stadt und ihren Bürgern fetzen Kugeln und Bomben um die Ohren, von allen Seiten. Die vor langer Zeit als „Stadt des Friedens“ gegründete Metropole am Tigris liegt in Schutt und Asche. Pures Entsetzen und Angst greifen um sich wie ansteckende Krankheiten. Nach Kriegsende, noch im selben Jahr, versinkt das arg gebeutelte Land in bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Das brache, vom Krieg ausgebrannte Land, wird zum Nährboden für neue Mächte in der Region. Fortan ringen sich politische und religiöse Gruppen aller Art um die Gunst der Stunde. Das Machtvakuum zieht sie an, wie Scheißhaufen Fliegen und sonstiges Gefleuch. Was folgt, sind unzählige Terroranschläge und Gewaltkriminalität. Die Opfer sind, wie zuvor auch, meist unschuldige Zivilisten. Mitten unter ihnen vier junge Metalheads mit nur einem Wunsch: Rocken als ob´s kein Morgen gibt (was jeder Zeit hätte passieren können, denn der Morgen war ihnen im Chaos von Bagdad schon lange nicht mehr gewiss).
Irgendwo in Bagdad, 2006. Vier junge Männer. Firas, Tony, Marwan und Faisal sind Anfang 20. Um sicher zu ihrem Proberaum zu gelangen, tragen sie Handfeuerwaffen zum Selbstschutz. Ihre Musik ist ihre Passion, sie ist ein bewusst gewähltes Werkzeug um die Schrecken des Alltags vergessen zu machen, erzählen sie zwei nordamerikanischen Filmemachern. Einer der vier meint: „We are living in a Heavy Metal World“, und stellt damit den Konnex zwischen ihrer Musik und ihrer Realität her: Diese Worte reflektieren die Fleisch gewordene, oder besser gesagt Metall gewordene Angst vor dem Tod im Krieg. Heavy Metal ist hier nicht nur Musik, er ist auch Synonym für die metallenen Bomben, die vom Himmel brechen. Die beklemmende und preisgekrönte Dokumentation „Heavy Metal in Baghdad“ erzählt eine berührende Geschichte davon: Die Geschichte der irakischen Metalband Acrassicauda. Das Kamerateam begleitet die sympathischen Jungs, unterbrochen durch monatelange, kriegsbedingte Drehpausen, durch ihren verstörenden Alltag: Acrassicauda erhalten Morddrohungen von Fundamentalisten – ihre langen Haare und Metallica-T-shirts machen sie zu deren Zielscheibe; ihr Proberaum wird durch einen Bombeneinschlag in die Luft gejagt; die wenigen Konzerte, die sie spielen können und dürfen, finden vor wenigen Freunden in geheim gehaltenen Locations, unter zum Teil drakonischen Sicherheitsvorkehrungen statt (das Misstrauen des militärischen Sicherheitspersonals ist groß, für die einen ist man „westlicher“ Verräter, für die Besatzer potentieller Terrorist). Trotz alledem: Seit langem können sie nun mit Hilfe des Filmteams für ein paar Stunden den Krieg und seine Gräuel vergessen, spielen endlich wieder ein Konzert und feiern eine frenetische Heavy Metal Party. Später wird sich die Band längere Zeit nicht mehr sehen, es wird zu gefährlich werden, die Häuser zu verlassen. Irgendwann wurde dann klar, so erzählen sie den Filmemachern bei deren nächsten Besuch, dass es hier nicht mehr auszuhalten ist, etliche Freunde sind tot oder geflohen. Die Ohnmacht gegenüber Terror, Verlust und Zerstörung machen ein Weiterleben hier zu einer schrecklichen Qual. Ihre Verzweiflung hat das Höchstmaß erreicht. Der Konflikt hat sich zu gespitzt, Leichen liegen auf den Straßen, der Tod schwebt über allem, sie könnten die nächsten sein. Die Band entschließt sich, nach Syrien zu fliehen. Die „Heavy Metal Refugees“ beginnen eine acht Jahre andauernde, gefährliche Flucht, die sie schlussendlich bis in die USA führt. Der Kontakt zum Filmteam reißt inzwischen über längere Zeit ab.
New Jersey, 2015. Acrassicauda veröffentlichten nach einer Crowdfunding-Kampagne ihr erstes Studioalbum „Gilgamesh“ (als Produzent wirkte übrigens unter anderem auch ein gewisser Herr Alex Skolnick mit). Trotz aller Widrigkeiten, die Band hat ihren Traum auch als Kriegsflüchtlinge nicht aufgegeben. Zwischen ihrer gelungen Flucht und Gilgamesh stehen drei US-Tourneen, eine EP, Musikvideos und über 24.000 Facebook-Fans. Acrassicauda haben es geschafft. Sie sind musikalisch und optisch kaum wiederzuerkennen. Was Freiheit ausmacht!
Gilgamesh ist Acrassicaudas Vertonung des gleichnamigen Epos, ihr Oratorium zur legendären Thematik: Eine antike Erzählung aus altbabylonischer Zeit über die Sterblichkeit des Menschen, den viel zitierten Sinn des Lebens und die Liebe. Gilgamesh, das ist bei Acrassicauda Thrash Metal mit orientalischem Ambiente. Schon die kurze Einführung in das Machwerk der Iraker „Cedar Forest“ kündet davon. Noch ist es nur eine geheimnisvoll-ruhige, instrumentale Vorahnung, die gehört wird. Man ist gespannt und neugierig und ahnt schon, dass da was schwelt, das es zu entdecken gilt. Wie ein Abenteurer ein ihm fremdes Land entdeckt - so wird es sein. Dann kommt „Rise“ als zweite Nummer und lüftet den Vorhang zur Abenteuerreise: Heftige Powerriffs, Double Bass-Gewitter, feister, wummernder Bass und Kehlkopfakrobatik. Gitarrensoli wie Elegien, gravitätisch und düster ist´s. „Quest for Eternity“ zeigt dann, was bei Acrassicauda sonst noch alles drin ist: Abwechslung und Vielfalt, progressive Rhythmen und melodischer Gesang gesellen sich zum Brachialen. Nummer vier heißt „Amongst Kings and Men“. Ein Meisterwerk, groß und mächtig wie eine Kathedrale. Auf „Shamhat“ (so heißt übrigens die verführerische Priesterin aus dem Gilgamesch-Epos) folgen Perkussionen die an das alte Mesopotamien erinnern. Dann „The Cost of Everything & The Value of Nothing“: Eine arabische Darbuka trommelt den Anfang, bevor es wiedermal drastisch zu und her geht: Nahost-Flair kandiert mit Heavy Riffs und gutturalem Getöse. Überhaupt muss gesagt werden, dass vor allem in Sachen Rhythmik und Percussion viel auf Gilgamesh passiert und ausprobiert wird, was man erfreut zur Kenntnis nimmt. Ganz klar eine der Stärken der Band aus Bagdad.

„Requiem for a Reverie“ ist die Ballade des Albums. Sie ist solide und zeigt, dass die Jungs auch anders können. Wie gesagt, Abwechslung steht auf dem Programm. Das Gitarrensolo erinnert an Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht. „House of Dust“ hingegen, beginnt wie eine Erzählung aus 666 und einer Nacht, geht auch so weiter und endet so; baut sich dabei vor dem schockgefrorenen Zuhörer auf wie ein gewaltiger Kaventsmann, um dann erbarmungslos über ihm zusammenzubrechen: eben gekonnt intonierter Thrash Metal aus dem Irak. „Unity“ besticht durch ein in Höchstgeschwindigkeit vorgetragenes Riff und einem Erzähler, der aus dem Off auf Arabisch zu einem spricht. Man würde zu gerne wissen, was er wohl sagt. Auf „Elements“ kommt der für viele europäische Ohren so exotisch anmutende, emotional vorgetragene, arabische Gesang zum Tragen und bildet eine perfekt gelungene Symbiose mit zornigen Riffs und derbem Rhythmus. Auf diese Melange hat man eigentlich seit Beginn des Albums gewartet. Ansonsten ist „Elements“ eine der wenigen Kompositionen, die zwischendurch mit High Speed Drums zu beeindrucken versteht. Der Vorabend des Albums nennt sich „Uruk“ (so heißt die Stadt des mythischen Königs Gilgamesch aus dem gleichnamigen Epos). Es wird wieder geheimnisvoll gen Schluss hin: Orientalische Lauten, ein Klavier, arabische Perkussion und Streicher erzählen tonale Geschichten aus einer babylonischen Wüstennacht. Ein Stück wie ein klandestines Treffen, nächtens, im Schutz des Schattens der sagenumwobenen Stadtmauer Uruks. Man scheint angekommen. Die abenteuerliche Entdeckungsreise findet hier ihr Ende. Naja, fast. Auf „Rebirth“ wird’s nochmal gewohnt bös. Sänger Faisal beweist ganz zum Schluss, dass er nicht nur recht gut Krakeelen sondern auch richtig fein singen kann. „The war is not over, the worst is yet to come, evolution led by rage, marching to the sound oft he drum…Will we save us from what we´ve become.“
Gilgamesh, das ist die Genese akustischer Überzeugungskraft, geballter Power durch Starkstrom und songtextlicher Authentizität; Wirklichkeit gewordene Dystopie, minutiös inszeniert, heiß wie die irakische Wüste, mit atmosphärischen Momenten, die man nicht so schnell vergisst. Ein subkutanes Erlebnis.
Was soll man sagen? Man bleibt etwas wortkarg zurück. Denn auch für gerettete Kriegsflüchtlinge ist Krieg niemals vorbei. Ihre Seelen bleiben für immer ramponiert. Davon kündete schon Acrassicaudas 2010 erschienene EP „Only the Dead See the End of the War“ (Der Sound darauf fällt im Übrigen satter, klarer und somit um einiges besser aus, als auf Gilgamesh). Arassicauda sind trotzdem Speerspitze einer ganzen Generation junger Musiker, deren Träume und Hoffnungen sich auch vor Krieg und Terror nicht beugen. Sie gemahnen uns daran, dass vielen nicht erlaubt ist zu tun, was wir in Europa für selbstverständlich halten: Die Freiheit Musik zu machen oder zu hören wie es uns gefällt, ohne dafür verfolgt und ermordet zu werden. Schwer vor zustellen, aber genau das ist im heutigen Irak immer noch gang und gäbe. Acrassicauda zeigen des Weiteren, was manch einer immer noch nicht weiß: Auch abseits der „westlich“ dominierten Populärkultur wird in anderen Teilen der Welt gerappt, gerockt und eben auch geheadbangt. In Bangladesch, Nigeria oder im Irak. Das ist gut zu wissen, weil Musik lässt Menschen näher zusammenrücken.
Oft wird ja davon geschrieben, wie Musik Grenzen niederreißt (die zuvor meist von kulturnationalistischen Misanthropen mühsam aufgebaut wurden); Acrassicauda haben genau das getan: jene Grenzen mit ihrer Musik eingestampft. Sie sind Evidenz dafür, dass kulturelle Unterschiede nur oberflächlicher Natur sind. Verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen sind sich viel ähnlicher als manch einem lieb ist. Die grundlegenden Bedürfnisse sind nämlich dieselben. Und weil es hier um Heavy Metal geht: Das Bedürfnis und Recht zu rocken bis zum Abwinken, gilt für alle. Acrassicauda haben durch die Hände ausländischer Soldaten Freunde verloren. Ausländische Soldaten durch Irakische Hände ihr Leben gelassen. Und während Iraker US-Amerikaner hassen und US-Amerikaner Iraker hassen, sind Acrassicauda schon längst durch die USA getourt und haben mit US-Amerikanern und Menschen aus aller Welt gemeinsam sich selbst und ihre Musik gefeiert. Das mag pathetisch klingen, ist aber trotzdem so. Da erscheint alles andere plötzlich als stupide Zeitverschwendung. Heavy Metal: Musik die Grenzen einreist. Auf österreichisch könnte man auch sagen: Do kummn d´Leit zam. Oder mit James Hetfield: „What an awesome story. This inspires me alot. In the world certain cultures are the way they are but music doesn´t care. There are no boundaries for music. It connects right here in your heart. You can´t stop it. So, right on!“
Die vier Schwermetaller sind Vertreter, und Spitze des Eisberges all jener musikalischen Subkulturen, die im Irak und anderen unterdrückten Ländern leben und nicht gehört werden.
Wenn sie von Krieg singen, dann wissen sie tatsächlich wovon sie singen.
Acrassicauda = Kulturkämpfer, Metalguerillas.
Erscheinungsdatum: 04. April 2015
Label: Independent
Tracklist
1. Cedar Forest 1:29
2. Rise 5:04
3. Quest for Eternity 3:47
4. Amongst Kings and Men 5:11
5. Shamhat 0:25
6. The Cost of Everything & The Value of Nothing 3:09
7. Requiem for a Reverie 4:04
8. House of Dust 4:06
9. Unity 4:02
10. Elements 2:56
11. Uruk 2:02
12. Rebirth 4:32
Weiterführende Links
http://acrassicauda.com/
https://www.facebook.com/acrassicauda?fref=ts
http://acrassicauda.com/music
http://www.heavymetalinbaghdad.com/